-
Freitag, 24. Februar
-
Während Russland in der Ukraine einen militärisch hochaufgerüsteten Angriffskrieg führt, wird andernorts in Europa mit weniger sichtbaren Waffen um Einfluss gekämpft. So ist etwa Bulgarien seit langem Ziel von Desinformations- und Propagandakampagnen des Kremls und es ist in der Folge dieser Einflussnahmen keineswegs sicher, dass die Sympathien der Bevölkerung bei Brüssel – und Kyiv – liegen und nicht eher bei Moskau. Gleichzeitig haben auf dem Balkan wiederholt aufgeschobene, noch immer unverbindliche Beitrittsperspektiven der EU zunehmend Enttäuschungen hinterlassen und auch empfänglich gemacht nicht nur für den Einfluss Russlands, sondern ebenso seitens der Türkei und Chinas. Wie wird dieser Kampf um Einfluss geführt? Mit welchen Mitteln?
-
-
Samstag, 25. Februar
-
Mit einer rapide schrumpfenden Bevölkerung steht Bulgarien exemplarisch für das Gefühl existenzieller Bedrohung, das viele Länder Mittel- und Südosteuropas kennzeichnet. Auswanderung ist hier ein viel akuteres Problem als Einwanderung. Doch welche Strukturen verbergen sich hinter den Zahlen? Wie verändert die Migration sowohl die Herkunfts- als auch die Aufnahmeländer? Und ist der Import beispielsweise von gut ausgebildeten Ärzten und qualifizierten Pflegekräften wirklich eine Lösung für die alternden Gesellschaften im Westen?
-
Der Politikwissenschaftler Ivan Krastev war einer der ersten, der die Demografie als treibende Kraft in der zeitgenössischen europäischen Politik identifizierte – von der Renationalisierung bis zu fehlendem Zuspruch für demokratische Reformen. In Alek Popovs Roman Mission: Turan wird diese Angst vor demografischen Entwicklungen mit einer ironischen Wendung versehen: Eine Expedition bricht nach Zentralasien auf, um vermeintliche Ur-Bulgaren zu finden, diese für die Heimat zu rekrutieren und so die abnehmenden Bevölkerungszahlen auszugleichen. Absurd? Vielleicht. Aber wo genau verläuft die Grenze zwischen literarischer Satire und politischer Realität? Zwei der klügsten Köpfe und geistreichsten Intellektuellen Bulgariens erörtern ein Thema, das im Mittelpunkt der Lebensgeschichten vieler Europäer steht.
-
-
Sonntag, 26. Februar
-
Gerade als die EU an Schwung zu verlieren schien, zwang Russlands Krieg gegen die Ukraine die Mitgliedsstaaten, sich auf die Idee Europas als wertebasierte wirtschaftliche und politische Gemeinschaft zu besinnen. Es bleibt abzuwarten, wie lange dies anhalten wird, aber es hat sich gezeigt, dass die EU ein Objekt der Sehnsucht und der Identifikation sein kann – zumindest für Außenstehende. Kürzlich wurde der Ukraine und Moldau der Status der EU-Beitrittskandidaten zuerkannt. Andere, nicht zuletzt auf dem westlichen Balkan, hoffen auf konkrete Schritte ihrer Integration in die EU. Steht die EU noch für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Kann – oder muss – das politische Projekt Europa von der Peripherie aus erneuert werden? Welche Rolle kann und sollte Bulgarien bei einer solchen Erneuerung spielen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU?
-
-
Sofia 2023
24.-26. Februar | Bulgarien
Wir danken allen Teilnehmenden und Partnern für die interessanten und aufschlussreichen Diskussionen.
Vier Video-Mitschnitte der Veranstaltungen sind über YouTube verfügbar.
Nach einer über dreijährigen Pause freuen wir uns, das Programm der ersten umfassenden Debate on Europe seit der letzten Ausgabe in Belfast ankündigen zu können. Diesen Februar werden wir einen der Hotspots des krisengeschüttelten Europas besuchen.
Für alle, die verstehen möchten, welchen Herausforderungen die europäischen Gesellschaften heute gegenüberstehen, ist die bulgarische Hauptstadt Sofia derzeit einer der interessantesten Orte. Denn hier werden viele der aktuellen Konflikte besonders deutlich sichtbar.
Mehr als fünfzehn Jahre nach dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union ist der russische Einfluss nach wie vor groß und das Land tief gespalten in seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine und deren Folgen – etwa hinsichtlich Energiepolitik und Wirtschaftssanktionen. Darüber hinaus ist Bulgarien mit einer Bevölkerung von mittlerweile weniger als sieben Millionen Menschen ein Beispiel für die tiefe demografische Krise, die viele europäische Länder prägt. Zugleich ist Bulgarien ein Schlüsselland, das von der geographischen Peripherie der EU aus eine zentrale Rolle bei der Erneuerung des europäischen politischen Projekts spielen könnte.
All dies und vieles mehr steht auf dem Programm der Sofia Debate on Europe.
Die Veranstaltungen finden auf Englisch und Bulgarisch mit Simultanübersetzung statt. Eintritt ist frei, wir empfehlen aber Tickets zu reservieren.
Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache
Sofia Debate on Europe, 24.–26. Februar 2023
Die Sofia Debate on Europe wird an einem schicksalsschweren Datum der jüngeren europäischen Geschichte eröffnet: genau am ersten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine. Und bereits neun Jahre ist es her, dass die Revolution der Würde auf dem Kiewer Maidan ihren Höhepunkt erreichte und die nicht ganz so geheimnisvollen “kleinen grünen Männchen” auf der Halbinsel Krim auftauchten, was den eigentlichen Beginn des russisch-ukrainischen Krieges bedeutete.
Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache
Sofia Debate on Europe, 24.–26. Februar 2023
Die Sofia Debate on Europe wird an einem schicksalsschweren Datum der jüngeren europäischen Geschichte eröffnet: genau am ersten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine. Und bereits neun Jahre ist es her, dass die Revolution der Würde auf dem Kiewer Maidan ihren Höhepunkt erreichte und die nicht ganz so geheimnisvollen “kleinen grünen Männchen” auf der Halbinsel Krim auftauchten, was den eigentlichen Beginn des russisch-ukrainischen Krieges bedeutete.
Falls Europa einen weiteren Beleg dafür brauchte, wie kritisch die derzeitige geopolitische Konstellation tatsächlich ist, dann hat es diesen am 10. Februar 2023 bekommen, als die moldauische Premierministerin Natalia Gavrilita ihren Rücktritt ankündigte und das EU-Beitrittsland damit in eine politische Krise stürzte. Auslöser für Gavrilitas Rücktritt waren Nachrichten über einen russischen Plan, die prowestliche Regierung ihres Landes zu stürzen. Seitdem wurde in Chisinau zwar eine neue der EU zugewandte Regierung eingesetzt – die prorussischen Proteste werden gleichwohl von Tag zu Tag stärker.
Mehr als alles andere war dieses Geschehen eine Erinnerung daran, dass obschon der militärische Kriegsverlauf der „Spezialoperation“ nicht Russlands ursprünglichem Plan entspricht, gleichzeitig aber Putins hybride Kriegsführung anderswo in Europa durchaus erfolgreich ist.
Nur wenige Wochen vor den Ereignissen in der Republik Moldau hatte der investigativeJournalist Christo Grozev vor dem Parlament in Sofia erklärt, Russland habe für 2016 einen ähnlichen Staatsstreich in Bulgarien geplant. Diese Pläne, die seinerzeit vom russischen Militärgeheimdienst GRU orchestriert worden seien, konnten zwar rechtzeitig gestoppt werden, aber die brisante Lage Bulgariens – Mitglied der Europäischen Union, aber starkem russischen Einfluss ausgesetzt – bleibt unübersehbar. Dies gilt umso mehr nach dem 24. Februar 2022, als Russland die noch verbliebenen Reste der nach dem Kalten Krieg geschaffenen europäischen Friedensordnung ausgelöscht hat.
Einer der Grundsätze der Debates on Europe ist, sich auf Orte zu konzentrieren, an denen die Idee von Europa keine Selbstverständlichkeit ist, an denen vielmehr das Projekt Europa selbst auf dem Spiel steht. Dies war bereits bei der ersten Veranstaltung 2012 in Budapest der Fall. Und es fand seine Fortsetzung bei den Debatten in Charkiw und Sankt Petersburg, die beide nach der illegalen russischen Annexion der Krim und der Besetzung von Teilen der Ostukraine stattfanden, ebenso in Belfast, kurz vor dem Brexit. Aber noch nie in der Geschichte dieser Reihe stand so viel auf dem Spiel wie jetzt, wo wir in Sofia zusammenkommen.
So gibt es kaum einen besseren Ort als die bulgarische Hauptstadt Sofia, um zu verstehen, vor welchen Herausforderungen Europa heute steht. Hier werden viele der aktuellen Konflikte deutlich sichtbar. Im April finden in Bulgarien zum fünften Mal Parlamentswahlen innerhalb von nur zwei Jahren statt, und auch dieses Mal kann nicht selbstverständlich von einer stabilen Regierungsbildung ausgegangen werden.
Wie der Schriftsteller Georgi Gospodinov feststellte, ist eine polarisierte Gesellschaft wie die bulgarische durch einen fast vollständigen Zusammenbruch der Kommunikation gekennzeichnet. Es fehlt die Sprache für ein gemeinsames Gespräch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Bulgarien ist mit diesem Dilemma auf keinen Fall allein.
Die Sofia Debate on Europe soll daher einen Raum des Austauschs eröffnen, in dem die von Gospodinov so schmerzlich ersehnte Sprache entwickelt werden kann – als das Mittel, um eine grausame, konfliktreiche Realität zu begreifen, Lösungen und ernsthafte Zukunftsperspektiven zu formulieren – und dies nicht nur aus politischer Sicht, sondern auch gesellschaftlich und kulturell.
Ein solches Gespräch, eine solche Debatte über Europa, darf jedoch nie in der Annahme geführt werden, dass alles von einem neutralen Standpunkt aus diskutiert werden kann oder dass alle Meinungen gleichermaßen akzeptabel sind.
Im September 1939, als die totalitären Kräfte Europas auf dem Siegeszug zu sein schienen, saß Thomas Mann in Stockholm und schrieb an einer Rede, die er auf dem bevorstehenden Internationalen PEN-Kongress halten sollte. Der Titel seiner Rede lautete Das Problem der Freiheit. „Wir müssen es wagen, diese großen Worte wieder zu benutzen“, schrieb Mann. Worte wie “Freiheit”, “Wahrheit”, “Recht”. Und wir müssen wieder lernen, sie ohne die skeptische Distanz oder gar Ironie zu gebrauchen, mit der sie jahrzehntelang imprägniert worden sind. Tun wir das nicht, dann überlassen wir das Feld genau jenen Kräften, die das Völkerrecht ignorieren, die Lügen gleichermaßen über Vergangenheit und Gegenwart verbreiten und die der Freiheit ein Ende setzen wollen.
Thomas Mann konnte seine Rede nicht halten. Der PEN-Kongress in Stockholm wurde abgesagt, nachdem Hitler-Deutschland in Polen einmarschiert war. Doch der Text wurde umgehend vom Bermann-Fischer Verlag, damals im schwedischen Exil, veröffentlicht.
Wenn man etwas lernen kann aus Thomas Manns Reaktion auf die prekäre Situation, in der er selbst und die Welt sich damals befunden haben, dann ist es sicher nicht, in übertriebenem Pathos zu schwelgen. Nein, die Lektion besteht darin, auf den Werten und Prinzipien zu bestehen, die diese Worte beinhalten, und zu versuchen, eine angemessene Sprache zur Bewältigung der Krise zu finden.
Die Sofia Debate on Europe bietet die Gelegenheit, genau das zu tun. Es steht viel auf dem Spiel.
Antje Contius, Geschäftsleiterin der S. Fischer Stiftung
Carl Henrik Fredriksson, Programmleiter von Debates on Europe
Dessy Gavrilova, Vorsitzende des European Network of Houses for Debate “Time to Talk”
Ernst Osterkamp, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung
Programm
Mitwirkende
-
Iryna Vidanava

Iryna Vidanava ist Mitbegründerin und CEO von CityDog.io (vormals CityDog.by), eines der führenden unabhängigen Online-Medien für Minsk, Belarus und Belaruss:innen weltweit. Vidanava ist eine international anerkannte Expertin, Forscherin und Beraterin, außerdem Autorin mehrerer Publikationen zum Thema Medien, Zivilgesellschaft und staatliche Politik in Belarus. Sie ist Vorstandsmitglied des belarussischen Journalistenverbands und des belarussischen Weltverbands “Batskaushczyna”. 2014 stand sie auf der Liste der Top 100 Innovator:innen Mittel- und Osteuropas (NewEurope100.org).
-
Carl Henrik Fredriksson

Carl Henrik Fredriksson ist Redakteur, Essayist und Übersetzer und lebt in Wien. Er ist Mitbegründer der journalistischen Onlineplattform Eurozine und war bis 2015 deren Chefredakteur und Leiter. Auch war er Chefredakteur des ältesten schwedischen Kulturmagazins, Ord&Bild. Heute ist Fredriksson Programmdirektor der Debates on Europe und Permanent Fellow des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin.
-
Senad Pećanin

Senad Pećanin lebt und arbeitet als Anwalt, Journalist und Herausgeber in Sarajevo. Er ist eines der Gründungsmitglieder des Helsinki Committee for Human Rights in Bosnien und Herzegowina und arbeitet zu Menschenrechten und Demokratisierungsprozessen in Südosteuropa. 1992, während der Belagerung Sarajevos, gründete er das unabhängige Wochenmagazin Dani.
-
Alek Popov
Daniel Nenchev

Alek Popov ist bulgarischer Schriftsteller, der vor allem für seine oft ironischen und satirischen Romane und Erzählungen bekannt ist. Er ist außerdem Autor mehrerer Drehbücher und auch Theaterstücke, die auf nationalen und internationalen Bühnen inszeniert werden. Mission: Turan ist sein jüngster Roman – darin macht sich der Schriftsteller, als Anthropologe getarnt, auf den Spuren seiner Figur nach Südsibirien auf, um den sogenannten Ur-Bulgaren ausfindig zu machen. Seine Texte sind vielfach übersetzt und wurden u.a. mit dem Elias Canetti-Preis ausgezeichnet (2007). Popov war Writer in Residence des Institute of Advanced Studies der CEU in Budapest und ist korrespondierendes Mitglied der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften (Kunstsektion). Er lebt in Sofia.
-
Bilyana Kourtasheva
NBU

Bilyana Kourtasheva ist Literaturwissenschaftlerin und lehrt als außerordentliche Professorin an der Neuen Bulgarischen Universität (NBU) in Sofia. Zu ihren Veröffentlichungen zählen die Publikationen On the Edge of Comparison ( 2018) und Anthologies and Canon: Anthological Models of Bulgarian Literature (2012). Kourtasheva ist Mitautorin des Bandes Bulgarian Literature as World Literature (2020). Sie war eine der Mitbegründer:innen und Herausgeber:innen der experimentellen Literaturzeitschrift Vitamin B (1996-1999). Seit 2000 ist sie Chefredakteurin von SLEDVA, der NBU-Zeitschrift für Geisteswissenschaften und Kunst.
-
Daniel Smilov

Daniel Smilov ist ein vergleichender Verfassungsrechtler und Politikwissenschaftler und ist außerordentlicher Professor für politische Theorie an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität Sofia, Bulgarien. Smilov ist auch Programmdirektor des Centre for Liberal Strategies in Sofia, und immer wieder Gastprofessor für vergleichendes Verfassungsrecht an der Central European University, Budapest/Wien.
-
Dessy Gavrilova

Dessy Gavrilova ist bulgarische Kulturvermittlerin, Kuratorin, Kulturberaterin und Dramaturgin. Sie lebt in Wien und ist die Gründerin von Time to Talk, einem europäischen Netzwerk von Debattenhäusern, das in über 20 Ländern tätig ist. Zuvor war sie Mitbegründerin und Leiterin des Red House Center in Sofia. 2016 war Gavrilova Initiatorin und Mitbegründerin des Humanities Festivals, eines jährlichen Events, das sich rasch als feste Größe im Wiener Kulturleben etabliert hat. Zuletzt gründete sie Knigovishte, ein Start-up, das Lesen und Medienkompetenz unter Kindern fördert. Gavrilova hat zahlreiche internationale und nationale Institutionen beraten, darunter die Europäische Kommission, den Europarat und die Open Society Foundation. 2011 stand sie auf der Liste der 100 einflussreichsten Frauen Bulgariens.
-
Dimiter Kenarov

Dimiter Kenarov ist freiberuflicher Journalist, Dichter und Kritiker, sowie Übersetzer. Seine englischsprachigen Texte sind u.a. im New Yorker, Esquire, The Nation, The Atlantic, Foreign Policy und in der New York Times erschienen und wurden dreimal in der Anthologie The Best American Travel Writing veröffentlicht. Derzeit lehrt er an der Amerikanischen Universität in Bulgarien.
-
Dubravka Stojanović

Dubravka Stojanović ist serbische Historikerin und Professorin an der Universität Belgrad. Sie forscht zu den Themen Demokratie in Serbien und der Balkanregion, Geschichtsnarrative in Schulbüchern, Sozialgeschichte, Modernisierungsprozesse und die Geschichte der Frauen in Serbien. Sie ist außerdem Vizepräsidentin des Ausschusses für Geschichtserziehung und Beraterin der Vereinten Nationen, und beschäftigt sich mit Fragen der Geschichte, des Gedächtnisses und des Missbrauchs der Geschichte in der Bildung.
-
Georgi Gospodinov
Phelia Baruh

Georgi Gospodinov ist einer der auch international angesehensten und bekanntesten bulgarischen Schriftsteller. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u.a. die Romane Natürlicher Roman und Physik der Schwermut. Für seine Prosa und Lyrik wurde Gospodinov u.a. mit dem Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus (2019) und dem Jan-Michalski-Preis (2016) ausgezeichnet. 2021 erhielt er für seinen Beitrag zur europäischen Literatur den Usedomer Literaturpreis; Jurypräsidentin war Olga Tokarczuk. Sein jüngster Roman Zeitzuflucht erschien im Frühjahr 2020 und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt . In Italien wurde Zeitzuflucht 2021 mit dem renommierten Premio Strega Europeo ausgezeichnet.
-
Ivan Krastev
Nadezhda Chipeva
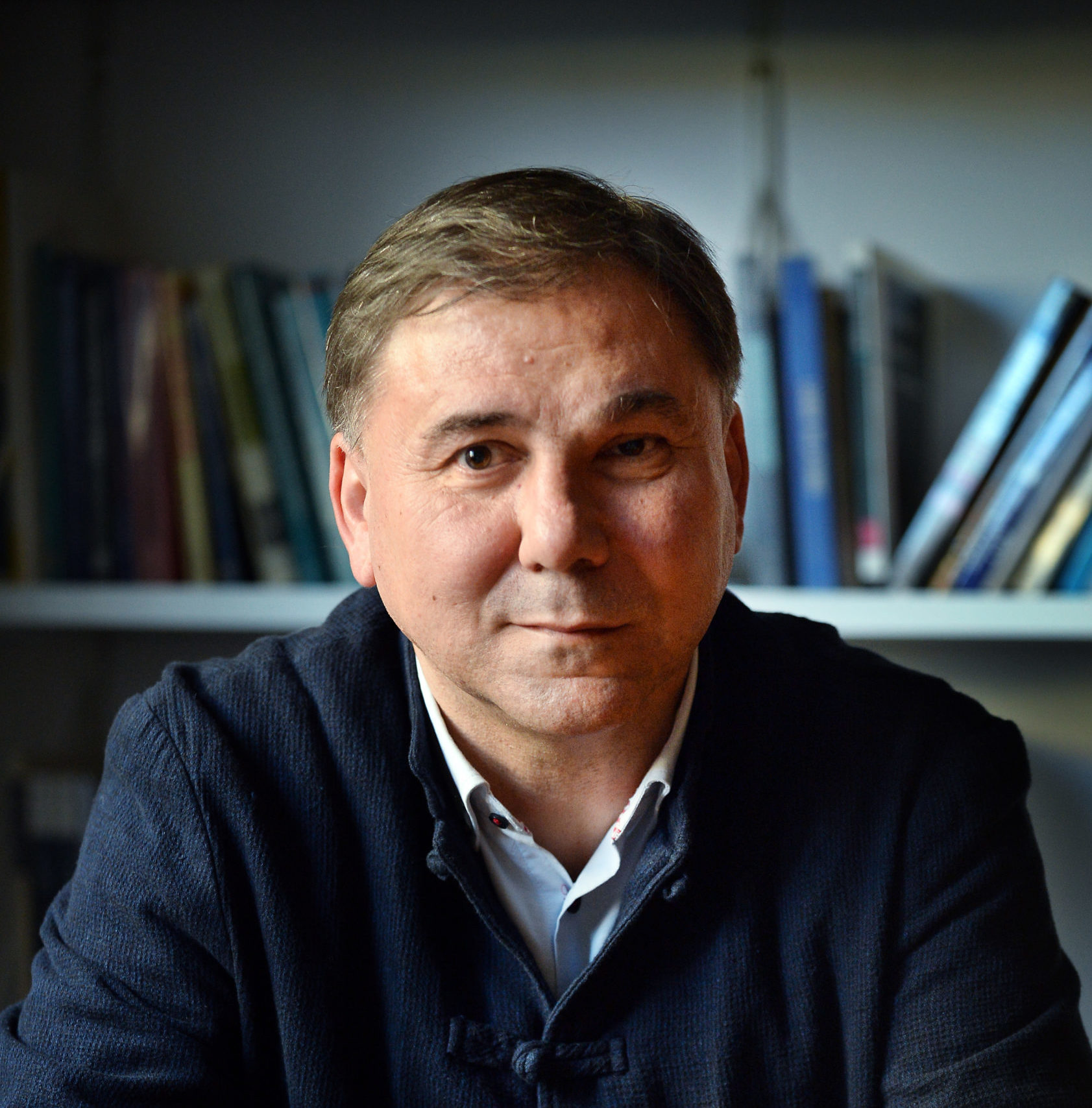
Ivan Krastev ist Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies und Permanent Fellow des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien, wo er auch lebt. Er ist Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations, Kuratoriumsmitglied der International Crisis Group und Vorstandsmitglied von GLOBSEC. Er schrieb für die New York Times (2015-2021) und ist derzeit mitwirkender Redakteur der Financial Times. Zu Krastevs Veröffentlichungen zählen u.a. Is it Tomorrow, Yet? How the Pandemic Changes Europe (2020) und, gemeinsam mit Stephen Holmes, The Light that Failed: A Reckoning (2019). Letztere wurde mit dem Lionel Gelber-Preis ausgezeichnet. 2020 erhielt Krastev den Jean Améry-Preis für europäische Essayistik.
-
Kateryna Mishchenko

Kateryna Mishchenko ist Schriftstellerin, Übersetzerin, sowie Kuratorin und Mitbegründerin von Medusa, einem unabhängigen ukrainischen Verlag. Sie lehrte Literatur an der Nationalen Linguistischen Universität Kyiv und arbeitete als Übersetzerin im Bereich der Menschenrechte. Ihre Essays wurden in ukrainischen und internationalen Anthologien und Zeitschriften sowie in dem Buch Ukrainische Nacht veröffentlicht. Bis vor Kurzem lebte und arbeitete Mishchenko in Kyiv. 2022 war sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ihr Buch Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine erscheint Mitte März in Deutschland.
-
Kristof Bender
Laszlo Thier
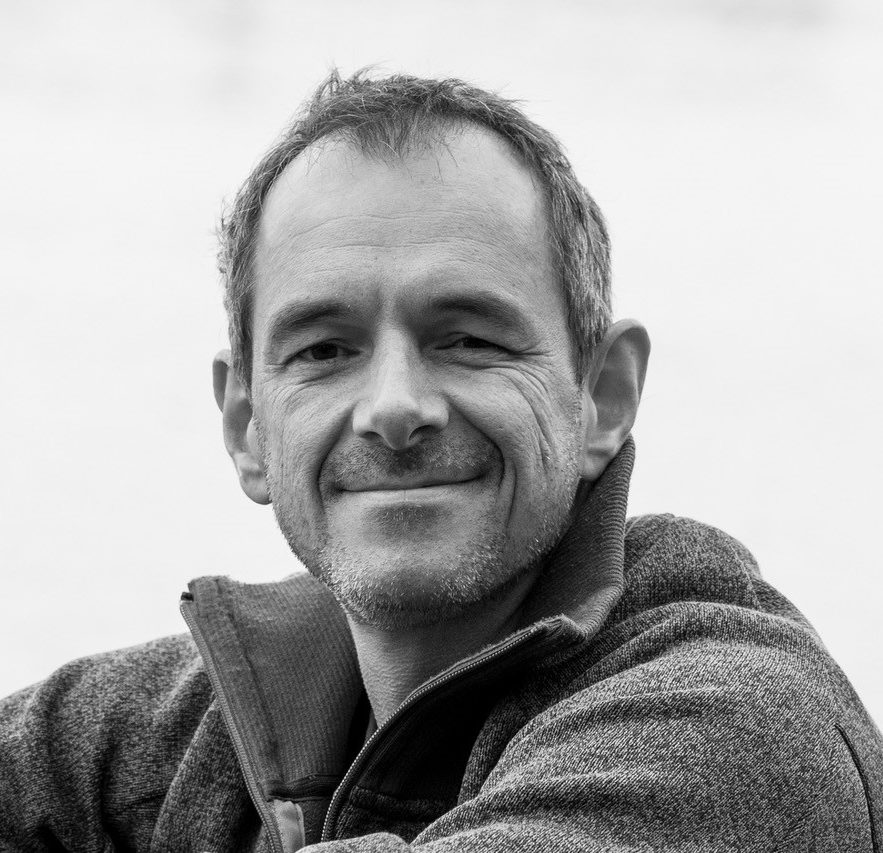
Kristof Bender ist stellvertretender Vorsitzender der European Stability Initiative (ESI). Er studierte Soziologie in Wien und Paris und ist seit 1997 in verschiedenen Funktionen in Südosteuropa tätig. Seit 2000 ist Bender Teil des ESI-Teams. Nach Stationen in Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, lebt er nun in Wien. Dort ist er derzeit Europe’s Futures Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM). Sie finden ihn online unter @kristof bender (Twitter) oder @kristof@eupolicy.social (Mastodon).
-
Ognyan Georgiev

Ognyan Georgiev ist langjähriger Reporter und Redakteur der führenden bulgarischen Wirtschaftszeitung Capital. Derzeit leitet er Kapital Insights, das englischsprachige Büro, sowie die neue regionale Zweigstelle von Capital in Plovdiv, Bulgariens zweitgrößter Stadt. Georgiev ist Alumni der Robert Bosch Stiftung und des Fulbright-Programms. Außerdem verbrachte er ein Jahr am MIT, wo er zum Thema Stadtmigration forschte. Er ist Autor von “The Grand Return: COVID-19 and Reverse Migration to Bulgaria”, einem Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem European Council of Foreign Relations erstellt wurde, sowie des Folgeberichts zum selben Thema über Bulgarien und Rumänien, publiziert in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission.
-
Stanislav Secrieru
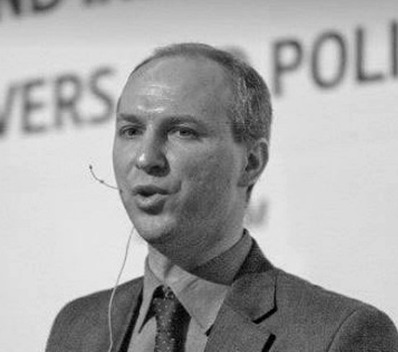
Stanislav Secrieru arbeitet seit 2018 als Senior Analyst beim European Institute for Security Studies (EUISS), wo er sich insbesondere mit Russland und der östliche Nachbarschaft der EU beschäftigt. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Beziehungen zwischen der EU und Russland, Russlands Außen- und Sicherheitspolitik im postsowjetischen Raum, Langzeitkonflikte und die Beziehungen der EU zu den Staaten der Östlichen Partnerschaft (ÖP). Bevor er zum EUISS kam, war Secreriu u.a. Senior Research Fellow am Polnischen Institut für Internationale Angelegenheiten (2014-2016) und Policy Analyst am Open Society European Policy Institute in Brüssel (2016-2017).
-
Tim Judah

Tim Judah ist britischer Journalist und Autor. Als Reporter ist er viele Jahre als Korrespondent für den Economist und die NYBB tätig; einen Großteil des letzten Jahres hat er in der Ukraine verbracht. Seit 2018 ist er Fellow des Europe’s Futures-Programms des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien, wo er eine großangelegte Untersuchung zum demografischen Wandel in Südost- und Mitteleuropa durchführt. Er ist Autor mehrerer Publikationen über den Balkan und veröffentlichte außerdem In Wartime: Stories from Ukraine (2016).
-
Veronica Anghel

Veronica Anghel ist Dozentin für Risk in International Politics and Economics an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Sie forscht insbesondere zur europäischen Integration und den Aufbau demokratischer Regime im postkommunistischen Europa. Derzeit ist sie Europe’s Futures Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien und Visiting Fellow am Robert Schuman Center des European University Institute (EUI) in Florenz. Zuvor war Anghel Max-Weber-Stipendiatin und Assistenzprofessorin am Politikwissenschaftsinstitut des EUI. Sie erhielt u.a. Forschungsstipendien an der Stanford University (Fulbright) und der Universität Bordeaux. Anghel ist außerdem Robert Elgie Editorial Fellow der Zeitschrift Government & Opposition.
-
Vessela Tcherneva

Vessela Tcherneva ist Vizedirektorin des European Council on Foreign Relations und Leiterin des ECFR-Büros in Sofia. Ihre Schwerpunktthemen sind die EU-Außenpolitik, der Westbalkan und die Schwarzmeerregion.
-
Misha Glenny
Klaus Ranger

Misha Glenny, Rektor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), ist Journalist, Autor und öffentlich weithin engagierter und wahrgenommener Intellektueller. Für den Guardian berichtete er über die Revolutionen 1989 und die Kriege in Jugoslawien, auch als langjähriger Mitteleuropa-Korrespondent der BBC. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Reportagen und Analysen über den Zerfall Jugoslawiens und die Balkankriege sowie vielfach beachtete Publikationen über das organisierte Verbrechen und Cyberkriminalität.
-
Milena Iakimova

Milena Iakimova ist außerordentliche Professorin an der Fakultät für Soziologie der St. Kliment-Ohridski-Universität und Mitglied der Stiftung für geisteswissenschaftliche und soziale Studien in Sofia. Sie ist Autorin der Monografien Sofia of the Common People (With a Tarikat Slang-Bulgarian Dictionary) (2010), How a Social Problem Arises (2016) und Fear and Propaganda (2022). Ihre Interessensgebiete sind die kritische Gesellschaftstheorie, kollektive Identitäten und kollektive Mobilisierung sowie Propagandaforschung.
-
Michael Martens
Frank Roth

Michael Martens ist Journalist und Autor. Er lebte ab 1995 mehrere Jahre in Russland, der Ukraine, Kirgisien und Kasachstan, bevor er 2002 nach Belgrad umzog, wo er sieben Jahre blieb. Danach folgten sechs Jahre in Istanbul und drei in Athen. Heute lebt Martens in Wien. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u.a. Ich werde die Wunde offen halten. Ein Gespräch mit Günter Grass (1999) und Irrfahrten. Ein ostjüdisches Leben (2000). Heldensuche. Die Geschichte des Soldaten, der nicht töten wollte erschien 2011, gefolgt von der Biographie Im Brand der Welten. Ivo Andrić. Ein europäisches Leben in 2019.
Partner
Gefördert durch das Auswärtige Amt
Medienpartner
Team
Carl Henrik Fredriksson
Programmleiter
Dessy Gavrilova
Programmberaterin
Barbara Anderlič Projektleiterin
Lora Fileva
PR
